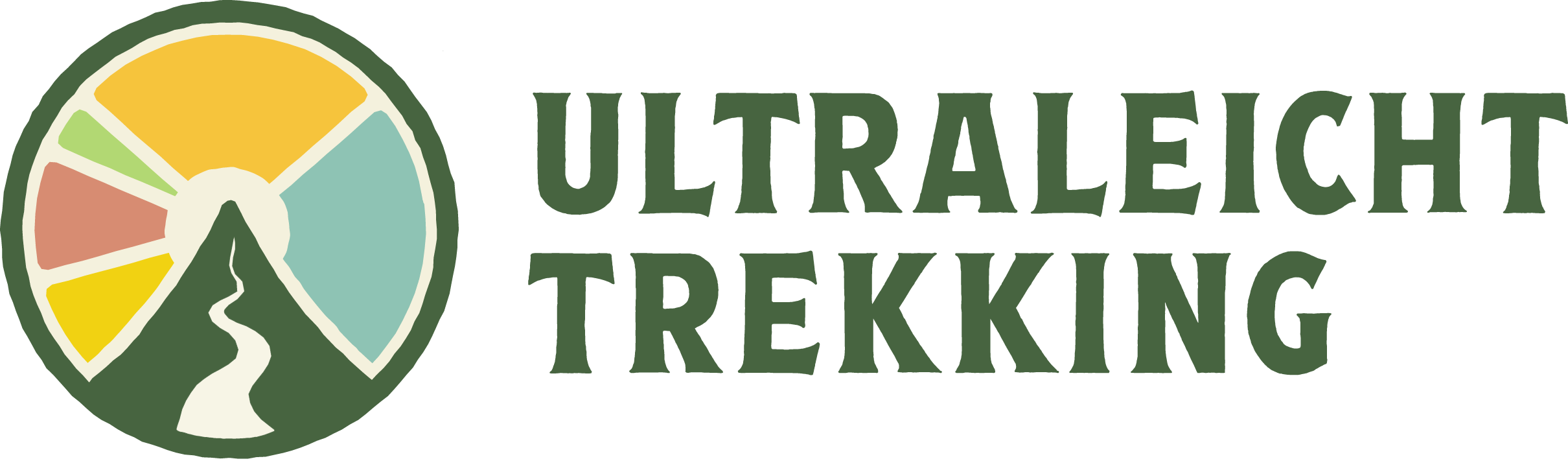XFoil ist mir kein Begriff.
Mit was ist es denn so vergleichbar was Stabilität und Weiterreissfestigkeit angeht ?
XFoil ist mir kein Begriff.
Mit was ist es denn so vergleichbar was Stabilität und Weiterreissfestigkeit angeht ?
Obwohl ich wilbo s Argument einsehe, schleppe ich meist ein schmales Stück Tyvek mit.
Das vewende ich einfach um bei Pausen darauf rumzuliegen, oder je nachdem auch zum Draufknien vor dem Zelt o.ä. wenn der Boden nass ist.
Da ich es dann eh mit dabeihabe, schiebe ich es normalerweise nachts unter den Liegebereich und habe so einen Schutz gegen Verschmutzung, und der Zeltboden ist dann meist auch trockener beim Einpacken. Somit mache ich am Ende genau das, was ich eigentlich unnötig finde ![]()
Ich selbst gehöre leider zu denjenigen, die, sobald es kühl wird, recht schnell Probleme mit Feuchtigkeit haben.
Bist du vorsorglich vielleicht schon dicker angezogen, weil du erwartest, dass die Daune kollabiert? Vielleicht hilft dir das hier weiter.
Meine stärksten Erfahrungen mit zusammenfallender Daune habe ich tatsächlich beim Cowboy-Campen, wenn sich die Luftfeuchtigkeit von Außen im Schlafsack breit macht. Das war schon ein paar Mal sehr ordentlich.
Ich trage normalerweise oben nur einen dünnen Merino-Baselayer, und wenn es kalt ist, noch eine dünne 100er-Fleece-Jacke darüber. Unten sehr dünne Kufa-Longjohns. Alles hauptsächlich um den Schlafsack sauber zu halten.
Kondens beginnt immer im Fuss / Beinbereich, ist jedenfalls mein Eindruck.
Einigen hier bereitet die Feuchtigkeit im Schlafsystem Sorgen
Das seltsame ist, dass einige dauernd Probleme mit sich in den Daunen langsam sammelnder Feuchtigkeit haben, und andere fast nie. Ich zweifle nicht daran, dass beide Erfahrungen tatsächlich so sind, verstehe aber nicht, wie diese individuellen Unterschiede zustande kommen.
Ich selbst gehöre leider zu denjenigen, die, sobald es kühl wird, recht schnell Probleme mit Feuchtigkeit haben. Das betrifft Übernachtungen über der Baumgrenze in den Alpen, aber auch Touren im Herbst in Lappland, oder in kalten Nächten in der High Sierra. Bei mir hilft nur regelmässiges Trocknen alle paar Tage in der Sonne (wenn sie denn scheint) oder in Hütten, um den Schlafsack zu "resetten". Die Kondensprobleme habe ich auf unter einem relativ gut belüfteten Tarp. Ich habe mir jetzt eine VBL gekauft (WM HotSac), einerseits als Not-Backup, andererseits weil ich testen möchte, wie der funktioniert und ob sich damit die Kondensproblematik entschärft.
Das Problem: Geht man mit einem - 30 Grad System raus und es wird "nur" minus 10, so wird man kaum Schlaf finden.
Das wiederum würde für einen warmen, grosszügig geschnittenen Quilt sprechen, in den man sich einrollen kann, ohne dass von der Seite frische Luft reinkommt. Und eher ein -15-Grad-System, das man mit zusätzlicher Kleidung pimpen kann.
Einen Schlafsack (oder Quilt) für "normale" Temperaturen zu nähen, ist nicht so schwierig . Bei minus dreissig spielen aber viele Details, die bei minus zehn noch nicht so kritisch sind, plötzlich eine Rolle. Differentialschnitt wurde schon genannt, dann müssen RV abgedeckt werden, der Halsabschluss ist kritisch (viele Schlafsäcke mit Kapuze haben gleichzeitig einen Halsabschluss).
Auf der anderen Seite ist Ray Jardine mit seiner Frau auf Skiern zum Südpol, und hat dafür seinen Apex-Quilt in Variante dick mitgenommen, und das hat offenbar gut geklappt. Das zeigt, dass es selbst unter extremen Bedingungen auch mit relativ einfachen Mitteln geht.
Ich würde sagen, das ist halt richtig.
Danke für die Anregung zum Nachdenken. Ich bleibe allerdings bei meinem Standpunkt. Wikipedia liefert dazu die Peukert-Gleichung. In der englischen Variante gibt es noch einen prima Hinweis, warum das mit den Ladungen nicht ganz so einfach (was reingeht muss auch rauskommen) ist: Es wird auf die Selbstendladung von Zellen verwiesen. Ich bin kein Chemiker, sondern Elektriker und habe keine Erklärung dafür, was genau in der Zelle passiert. Aber ein Wirkungsgrad von 1 sollte ohnehin fragwürdig erscheinen.
(Edit: Belege habe ich auch keine weiteren, aber vielleicht lässt mich das Thema übers Wochenende nicht los und ich forsche tiefer.)
Selbstentladung ist natürlich schon ein Phänomen, aber hier geht es ja um was anderes, oder? Mein Verständnis ist, dass bei Selbstentladung die Ladung statt "aussen rum" über den Stromkreis direkt von einer Halbzelle in die andere geht.
Was ich bei meinen Versuchen damals gemacht habe:
1. ich habe meinen Testakku mit einem definierten Strom belastet (mit einer Schaltung, die den Strom regelt), und auf eine definierte Endspannung entladen
2. dann habe ich den Akku wieder mit einem definierten konstanten Strom aufgeladen, bis zu einer vernünftigen Schlussspannung. Aus Strom x Zeit habe ich dann die hineingepumpte Ladungsmenge berechnet.
3. dann habe ich den Akku wieder wie im Schritt 1. entladen und dabei die Ladungsmenge bestimmt.
Die Idee war, dass nach Schritt 1 und Schritt 3 der Akku in genau demselben Zustand sein sollte. Bei den Strömen, die ich verwendet habe, war die Ladungsmenge in 2 praktisch zu 100% identisch mit der entnommenen Ladungsmenge in 3. Das hat mich erst erstaunt, danach kam mir das aber ganz vernünftig vor (eben, wo sollen die Ladungen sonst hin?)
Ich habe das aber nicht mit extremen Strömen gemacht, da meine Schaltung damals noch keine Zwangskühlung hatte. Jetzt habe ich einen kleinen Ventilator zugebaut, der bei höheren Entladeströmen automatisch angestellt wird.
Der Peukert-Effekt war mir kein Begriff, da es aber immer was Neues zu lernen gibt, habe ich mal Google befragt und auf Wikipedia folgendes gefunden (die deutsche und englische Seiten sind nicht identisch, da ich dies so nur auf Englisch gefunden habe gebe ich hier einen Auszug aus der englischen Seite wieder:
Explanation
It is a common misunderstanding that the energy not delivered by the battery due to Peukert's law is "lost" (as heat for example). In fact, once the load is removed, the battery voltage will recover, and more energy can again be drawn out of the battery. This is because the law applies specifically to batteries discharged at constant current down to the cut-off voltage. The battery will no longer be able to deliver that current without falling below the cut-off voltage, so it is considered discharged at that point, despite significant energy still remaining in the battery.
(...)
Given time, the active material will diffuse through the cell (for example, sulfuric acid in a lead–acid battery will diffuse through the porous lead plates and separators) and be available for further reaction
(...)
In fact, a battery which has been discharged at a very high rate will recover over time, and the remaining capacity can be retrieved after the battery has been left at rest for several hours or a day. The remaining capacity can also be withdrawn by reducing the current.
Das würde bedeuten, dass der Peukert-Effekt sich nur darauf bezieht, dass bei gegebenem Entladestrom weniger Kapazität nutzbar ist, da die Entladeendspannung früher erreicht wird. Es wird dann aber auch weniger Ladung benötigt, um den Akku wieder ganz zu füllen, da er eben weniger stark geleert wurde.
For example, consider a battery with a capacity of 200 Ah at the C20 rate (C20 means the 20-hour rate – i.e. the rate that will fully discharge the battery in 20 hours – which in this case is 10 A).
If this battery is discharged at 10 A, it will last 20 hours, giving the rated capacity of 200 Ah.
However, the same battery discharged at 20 A may only last for 5 hours. Therefore, it only delivered 100 Ah. This means that it will therefore also be (nearly) fully charged again after recharging 100 Ah – while the same battery which was previously discharged with I20 = 10 A and lasted 20 hours will be nearly fully charged after recharging 200 Ah.
Yepp, bezog sich auf deinen Beitrag drüber. Wenn sich das gelbe Forum schon als "bessere" Variante zum blauen Forum verstanden werden will sollten die Informationen hier aber auch belastbar sein.
Ich will jetzt hier keinen endlosen Streit lostreten, bin aber mit dir einverstanden, dass Informationen belastbar sein sollten.
Ich bezog mich auf meine eigenen Messungen direkt am Akku, und mein Verständnis der Zellchemie. Ich lasse mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen, dafür müsstest du aber Messungen oder einen Verweis auf eine konkrete und vertrauenswürdige Quelle liefern. Bisher habe ich aber nichts dergleichen gesehen. Ich wäre froh, würdest du hier konkret etwas nachlegen...
Das die in die PB eingelagerte Energie in Ah gemessen ähnlich ist wie die entnommene ist irrelevant, weil an dieser Schnittstelle keiner tätig ist
Jetzt definierst du aber die ursprüngliche Frage aber um ![]()
Die Diskussion hat ja damit angefangen, weshalb 4 x 2200mAh in den vier Enelope-NiMH Akkus nicht gleich ergiebig sind wie die 10000mAh einer LiIon-Zelle. Und dass die Kapazität in mAh sich meist auf die Akkukapazität bezieht, die dort drin verbaut ist... das habe ich ja alles ausführlich vor unserem Austausch diskutiert:
Die Stromabhängigkeit der Verluste besteht nicht nur bei der Elektronik sondern auch bei der Chemie der Zellen.
Hast du da eine Quelle, die konkret zeigt, was denn anderes passiert bei einem tiefen und hohen Strom (in einem vernünftigen Bereich), und wie bei hohem Strom eine Reaktion stattfindet, die dazu führt, dass die Ladung nicht am Ende wieder entnommen werden kann? Mich interessiert das wirklich, und ich lasse mich da auch gerne belehren. Ich selbst bin zwar Chemiker, aber kein Spezialist für Akkuchemie, und mein Studium liegt auch schon eine Weile zurück...
Was ich schrieb, ist dass im Akku gleichviele mAh wieder entnehmbar sind wie vorher reingeladen wurden... nicht aber Energie, da am Innenwiderstand des Akkus Wärme entsteht, und dieser Verlust hängt vom Lade/Entladestrom ab.
Ist halt falsch. Das fällt schon zusammen, wenn man den gleichen vollen Akku mit 0,1 C oder 2 C zu entladen versucht. Man wird dabei einen deutlichen Unterschied in der entnommenen Ladung (Amperestunden) messen.
Ich würde sagen, das ist halt richtig. Hast du das mal selbst gemessen? Das Wichtige ist, dass du nicht misst, was bei der Powerbank hinten rauskommt, sondern direkt am Akku (vor dem Schaltregler).
Ich habe viele solcher Messungen gemacht beim Bau meiner Solarlader. Ich habe das mit dieser Schaltung hier gemacht, und so Akkus systematisch auf- und wieder entladen, und den Wirkungsgrad dieser Setups gemessen (inkl. Schaltregler). Die dem Akku entnommene Ladung hängt nur dann vom Strom ab, wenn du bei einem hohen Strom bei der gleichen Akkuendspannung aufhörst (da diese aufgrund des Innenwiderstands des Akkus tiefer ausfällt). Wenn du, um bei deinem Beispiel zu bleiben, erst mit 2C entlädst, bis der Akku bei der Landendspannung ist, und dann nochmals mit 0.1C, bis wieder die Endspannung errreicht ist, hast du am Ende die gleiche Ladung (mAh) entnommen.
Am Ende ist es auch eine einfache Frage der Redoxchemie: Wo sollen denn die Ladungen sonst hingehen, die da in den Akku rein- und rausbewegt werden?
Und selbst der Vergleich von Wattstunden ist nicht ganz ohne Vorsicht zu betrachten, denn auch die entnehmbare Energie aus einer Zelle hänge davon ab, wie schnell ich sie entnehme. Bei größerer Leistung kommt weniger beim Verbraucher an.
Genau aus dem von mit genannten Grund: Bei einer höheren Entnahmeleistung (=höherer Entladestrom) fällt eine höhere Spannung am Innenwiderstand der Akkuzelle ab. Aber die entnommene Ladung (="Elektronenmenge") ist die gleiche.
Das glaube ich dir sofort. Die Differenz von ca. 8Wh sind am Innenwiderstand des Akkus verlorengegangen, sowie wahrscheinlich im Schaltregler (in diesem sättigt die verwendete Induktivität irgendwann, d.h. der magnetische Fluss nimmt mit zunehmender Stromstärke irgendwann nicht mehr proportional zu, und die Spule wird warm). Auch sind alle möglichen Widerstände zwischen Akkuzelle und Verbraucher weitere Verlustquellen, die bei hohen Entnahmeströmen zu grösseren Verlusten führen. So habe ich über USB-Steckkontakten auch schon 100-200mV Spannungsabfall gemessen. 200mV bei sagen wir 2A sind bereits 0.4W Verlust. Genau deshalb sind tiefe Ladeströme gut (z.B. USB PD bei hohen Spannungen, oder eben länger warten).
Äh, meinst du das ernsthaft??
Ich weiss jetzt nicht, ob du mich damit meinst ?
Das hieße ja, das sich die Wandlerverluste alleine in niedrigerer Spannung niederschlagen können (Energieerhaltungssatz!)? Du würdest dann also 10 Ah (10000 mAh ist nur dem Marketing für Dummies geschuldet, sieht halt nach mehr aus...) mit 5V in die PB laden und 10 Ah bei 5V - 30% (die Verluste) ergo 3,5 laden? Das habe ich bei zig Messungen von PBs nie erlebt und wäre mir völlig unerklärlich.
Was ich schrieb, ist dass im Akku gleichviele mAh wieder entnehmbar sind wie vorher reingeladen wurden... nicht aber Energie, da am Innenwiderstand des Akkus Wärme entsteht, und dieser Verlust hängt vom Lade/Entladestrom ab.
Im Wandler ist das wieder etwas anderes. Ein idealer Wandler wird die Energie (mWh) nahezu erhalten, und durch die Spannungsumsetzung unterscheiden sich die eingespeisten "mAh" von den abgegebenen.
Von daher macht es sehr viel Sinn (bzw. alles Andere ist Augenwischerei), sich ausschließlich auf die Wh als Größe zu beziehen. Vorbildlich sind hier die PB von Nitecore, die sowohl die theoretische Kapazität der verbauten Zelle als Capacity wie auch die am 5V Ausgang zur Verfügung stehende Energiemenge (Rated Energy) angeben.
Da hast du natürlich recht.
Was aber trotzdem für die Angabe der Kapazität von Akkus in mAh spricht, ist, dass beim Laden und Entladen (praktisch) keine Elektronen "verloren" gehen. D.h. wenn du 10000mAh in einen Akku "füllst", kannst du danach auch wieder 10000mAh entnehmen.
Bei der Energiemenge ist das nicht so, da dabei ein Teil davon am Innenwiderstand des Akkus verloren geht (als Spannungsabfall). Dieser Spannungsabfall, und die verlorene Energiemenge, ist nun aber stromabhängig. Wenn du also mit hohen Strömen lädst und entlädst, so verlierst du mehr Energie als Abwärme im Akku selbst, als wenn du dasselbe bei tiefen Strömen machst.
Das ist übrigens ein Grund, weshalb ich die Geräte, wenn Energie knapp ist, lieber langsam auflade. Eine PB muss von mir aus überhaupt keine Schnellladefunktion haben (bei der Energieabgabe an die Geräte).
Fast. Ohne Verluste wären 72Wh bei 5V gleich 72/5=14400mAh, nicht 12000mAh. Oder eben die Verluste betragen 17%.
Fairerweise muss man zu diesen Kapazitätsangaben sagen, dass die Angabe in mAh bei der Akkunennspannung schon sinnvoll ist, wenn sowohl die Powerbank als auch das Smartphone den gleichen Akkutyp haben, denn dann braucht man nicht auf eine andere Spannung umzurechnen. Es spielt dann auch keine Rolle, welche Spannung dir PB abgibt (5V oder mehr bei USB Power Delivery), da an Ende wieder zurückgewandelt wird.
Das funktioniert aber von NiMH auf LiIon nicht, da sich hier die Spannung um etwa den Faktor drei unterscheidet.
Kann mir mal wer das Problem erklären? Ich stehe aufm Schlauch
10000 mAh bei 1.2V sind 1.2Wh Energie.
10000 mAh bei 3.6V (Annahme bei Li-Ionenakku) sind 3.6Wh gespeicherte Energie.
In jeder Powerbank werkelt ein Schaltregler (typischerweise ein sog. boost converter), der den Strom, der vom Akku geliefert wird, mit einer Art Schalter "zerhackt", und die dabei in einer Spule erzeugte hohe Induktionsspannung benutzt, umd die Spannung des Akkus auf die gewünschten 5V (normalerweise bei USB, höher bei PD) hochzutransformieren. Dabei bleiben im besten Fall etwa 95% der Energie erhalten. Aber nehmen wir hier der Einfachheit halber an, es seien 100%.
Das bedeutet, dass bei der Entnahme von 1A bei 5V aus einem 1.2V-Akku 4.2A gesaugt werden. In der Praxis werden die NiMH-Akkus wohl in Serie geschaltet sein und im Summe 4.8V liefern. Dann müsste fairerweise aber die Kapazität mit 2500mAh angegeben werden, was hier offensichtlich nicht gemacht wurde.
Bei einem Li-Ionenakku mit 3.6V ist die Belastung bei 1A Entnahmestrom (bei 5V) nur etwa 1.4A.
Das heisst, im ersteren Fall sind die 10'000mAh in 2.4 Stunden aufgebraucht (die NiMH-Akkus leer), im zweiten Fall erst in 7.1 Stunden.
(das Problem ist also, dass die Kapazitätsangabe sich auf die Spannung des Akkus bezieht, und nicht auf die nominellen 5V der Powerbank)
Mit vier Panasonic Eneloop Pro AA ergibt das eine 10k Powerbank mit 163g, die gut mit niedrigen Temperaturen umgehen kann.
Das sind dann aber 10000mAh bei 1.2V, was etwa 3500mAh bei einer normalen Li-Ionenbatterie entspricht.
- Gewicht: Die meisten scheinen sich zwischen 170 und 270 g zu bewegen, wenn ich das richtig sehe. Kann denn jemand 170 g unterbieten? Das iPhone SE wiegt scheinbar nur 144 g – was ist davon zu halten?
Ich glaube, losgelöst von der Akkulaufzeit ist das Gewicht eines Telefons wirklich schwierig zu beurteilen. Auch die Displaygrösse ist ein Faktor.
Das iPhone SE scheine eine Batteriekapazität von ca. 2000mAh zu haben. Zum Vergleich: Mein Xiaomi Poco X3 pro hat eine von 5000mAh (und der Akku wiegt etwa 70g, jedenfalls die Ersatzakkus, die ich im Web gefunden habe). Für das iPhone SE wiegen die Ersatzakkus so um die 25g.
Wenn jetzt das iPhone nicht viel sehr haushälterischer mit der Energie umgeht, dann bedeutet das, dass es eine deutlich kürzere Akkulaufzeit haben müsste.
Für mich jedenfalls ist dann die Frage: Trage ich die Differenz in der Akkukapazität stattdessen als zusätzliche Powerbankkapazität mit rum? Und wie oft möchte ich das Smartphone überhaupt wieder aufladen müssen (egal ob von der Powerbank oder am Netz)?
Viele hier scheinen 2 Tage Akkulaufzeit bereits als gut zu empfinden. Mir persönlich wäre das viel zu wenig, da ich mich dann dauernd um den Ladezustand des Telefons kümmern müsste. Mit dem Poco X3 Pro komme ich im Alltag regelmässig auf 5 Tage, und @Wanderrentner 's X3 Pro hat offenbar locker 22 Tage durchgehalten, nachdem er es veloren hatte, und hatte immer noch einen ordentlichen Ladezustand (dabei spielt natürlich eine Rolle, wie weit es vom nächsten Funkmast aufbewahrt wurde, da das im Standby den Stromverbrauch wesentlich beeinflusst, aber ich denke, nach 3 Wochen noch 1/3 Ladezustand ist eine gute Leistung).
Ich persönlich würde mir für die UL-Trekkerei, sofern es um mehr als Wochenendtouren geht, ein Smartphone mit möglichst kleinem Display und möglichst fettem Akku suchen.
Zum Xiaomi (für alle, die mit Xiaomi's liebäugeln): was beim Xiaomi etwas ärgerlich ist, ist die ganze Bloatware, die da mitkommt. Mich nervt das, und ich habe mein X3 Pro erst ziemlich entrümpeln müssen, aber jetzt geht's. Irgerndwann werde ich da wohl LineageOS aufspielen.
Meine persönliche Strategie für längere Touren ist, ein kleines Solarpanel und eine relativ kleine Powerbank mitzutragen. Da die Sonne nicht immer scheint, bedeutet ein dickerer Smartphoneakku, dass ich dann mehr schlechte Tage überbrücken kann. Auf den beiden Kungsleden Mitte August bin ich so gut über die Runden gekommen.
Wer sich im Winter, mit „Campingequipment“, ins nördliche Skandinavien begibt, sollte absolut Professionelle Winterausrüstung mit haben, und über die nötigen Skills verfügen.
Dazu gibt es ja den entsprechenden Thread hier im Forum. Kälte lässt wirklich sehr wenige Fehler zu...
Die "Gegenstory" wäre diese: https://www.bbc.com/news/articles/cde78p3zx5ro. Hier hat jemand offenbar lange in der Kälte überlebt und wurde nach 5 Wochen lebend gefunden.
Kann mir das jemand physikalisch erklären?
Das ist jetzt etwas Spekulation, aber ich denke, die Erklärung ist Folgende:
- Eiswasser hat eine Temperatur von Null Grad Celsius. Da ist der Dampfdruck von Wasser sehr gering, laut Tabelle hier etwa 6 hPa
- Im Handschuh drin ist der Dampfdruck deutlich höher. Bei angenommenen 30 Grad beträgt der Sättigungsdampfdruck etwa 42h Pa.
Das heisst, bereits unter Sättigung im Handschuh drin sollte der Dampfdruckgradient die Diffusion durch die Membran hindurch zuverlässig antreiben.
Das passt auch zur Erfahrung, dass GoreTex im Wintersportbereich durchaus recht gut funktioniert. Jedenfalls ist das meine Erfahrung vom Winterbergsteigen.
Bonuspünktchen: auch der Rest hier scheint unbewandert zu sein, sonst wäre es irgendeinem der Leser hier zumindest aufgefallen, dass in Europa eine fünfstufige Lawinenskala verwendet wird. Nicht einmal das ist aufgefallen, und ich habe extra ein paar Tage Zeit verstreichen lassen und nicht sofort gekontert. Auf die Frage, wie denn der Lawinenkegel im Bild zustande gekommen sei, wenn doch laut Fachwissen 90% aller Lawinen von Personen ausgelöst werden, und somit der Bereich sicher sei, darauf habe ich nicht einmal gehofft, denn dazu müsste man ja mehr als das unterste Niveau beherrschen, und wissen, dass sich die Gefahrenlage über den Winter in den Bergen ändert.
Ja, mir ist das alles tatsächlich auch aufgefallen, alles andere wäre bei vielen Jahren Skitourenerfahrung auch merkwürdig gewesen. Und ich warne auch immer vor leichtsinnigen Wintertouren und Unterschätzung des Faktors Kälte (im alten und hier im neuen Forum). Das Bishorn und den Gletscher kenne ich übrigens auch, allerdings als Skitour.
Grundsätzlich finde ich, du hast mit praktisch allem, was du schreibst, in der Sache recht. Das schreibe ich als jemand, der bisher zum Glück selbst nie direkt betroffen war, aber leider schon Freunde und Bekannte durch Bergunfälle verloren hat. Mir ist Sicherheit in den Bergen ein grosses Anliegen, insbesondere im Winter.
Gleichzeitig finde ich aber auch, dein Ton ist häufig unkonstruktiv und am Ende entstehen "Schlagabtäusche", bei welchen es nicht mehr nur um die Sache geht. Das ist auch ein Grund, weshalb ich mich da nicht gerne einmische, und auch nur zurückhaltend Likes vergebe (aber ich habe deinen Beitrag oben geliked, weil ich ihn richtig und wichtig fand).
Ich finde, hier im Forum muss manchmal auch Dinge, mit welchen man nicht einverstanden ist, oder die objektivierbar sogar falsch sind, trotzdem einfach stehen lassen. Selbst bei diesem Thema. Ab und zu ein (freundlicher!) Hinweis erreicht am Ende mehr, als sich in Diskussionen zu "verbeissen" und Leute damit vor den Kopf zu stossen.
Es kommt mir halt vor, als würde jemand in einem Schachforum ständig die neusten Piratenabwehrmassnahmen diskutieren wollen -
Der Punkt ist halt, und da gehe ich mit Becks einig, dass viele hier Touren unternehmen, an welchen stellenweise Gefahren auftreten, die nicht anders sind als bei einer klassischen Bergtour. Da sie diese aber nicht als Bergtour betrachten, tendieren sie dazu, diese Gefahren zu verneinen oder gar nicht erst zu verstehen. Ein Sturm oder ein Biwak auf 3000m in den Alpen ist z.B. u.U. nicht unähnlich von dem, was auf wenig hundert m.ü.M. in Lappland passieren kann. Ditto kann eben ein Nassschneerutsch in einem Minitälchen richtig gefährlich sein (und wer schon mal versucht hat, in einem solchen Rutsch zu graben, weiss, wie schwierig das ist und wie wichtig eine gute Schaufel ist). Aber eben, c'est le ton qui fait la musique...
19 min. von 0 auf 100% sind >3C. (...) wirklich kritisch für die Degradation sind die Bereiche 0-10 und 80-100.
Smartphones sind halt Wegwerfartikel.
Da hast du schon recht.
Irgendwo habe ich aber beim rumstöbern gelesen, dass die Turboladefunktion eben nicht bis 100% rauf geht. Das würde ja passen. Beim Start ist der Ladezustand ja (meist) nicht 0 sondern >10%, dann könnte man ja schnell laden bis etwas unter 80%, und die erhöhte Temperatur wäre nicht so schlimm.
Häufig schnell "dreiviertelvoll" zu laden ist wohl eh. besser als selterner aber bis 100% zu laden.
Ob ich Akkuzellen zum Laden parallel oder in Serie schaltest, ist den Zellen egal. Und die dort beim Schnelladen erzeugte Hitze wird nicht "über das Ladegerät abgeführt" - oder hat das Ladekabel eine zusätzliche Kühlwasserleitung?
Es ist schlicht so, wie Mario294 schreibt: dieses superschnelle Laden weit jenseits 1C verschleißt den Akku schneller.
Genau, sowohl im Ladegerät also auch im Akku entsteht mehr Wärme bei höhere Ladeleistung... Die Verluste haben aber nichts miteinander zu tun. Im Ladegerät ist es der Wirkungsgrad des Schaltreglers, der die Verluste bestimmt. Im Smartphone der Innenwiderstand des Akkus plus ebenfalls Wandlerverluste in der Ladeelektronik.
Zu whr : Die Kabel (USB und Netz) führen schon auch etwas Wärme ab, was gerade bei einem Steckernetzteil nicht unwichtig sein dürfte.
Zum Schnelladen werden einfach höhere Spannungen auf dem USB-Kabel verwendet, da sonst die Ladeströme viel zu hoch würden. Bei Xiaomi sind das 20V bei 6A für die 120W. Das ist meines Wissens ausserhalb der Spezifikationen für Quick Charge über USB-A (eine Technik ähnlich wie PD). Mit USB Power Delivery über USB C sind solche Ladeleistungen und auch noch höhere Spannungen aber heute Standard.
Was wirklich dagegen spricht ist, wie whr und Mario294 schrieben, einfach die Abwärme. Bei meinem Poco X3 Pro habe ich das mal ausprobiert und danach das Xiaomi-Ladegerät so schnell wie möglich weggelegt, da das Handy für meinen Geschmack viel zu warm wurde, selbst wenn es an einem gut belüfteten Ort lag.
Update: Offenbar geht PD auch über USB-A, aber halt nicht bis 120W:
Hier habe ich folgendes gefunden:
In July 2012, the USB Promoters Group announced the finalization of the USB Power Delivery (PD) specification (USB PD rev. 1), an extension that specifies using certified PD aware USB cables with standard USB Type-A and Type-B connectors to deliver increased power (more than 7.5 W) to devices with greater power demands. Devices can request higher currents and supply voltages from compliant hosts – up to 2 A at 5 V (for a power consumption of up to 10 W), and optionally up to 3 A or 5 A at either 12 V (36 W or 60 W) or 20 V (60 W or 100 W). In all cases, both host-to-device and device-to-host configurations are supported.
(...)
PD-aware devices implement a flexible power management scheme by interfacing with the power source through a bidirectional data channel and requesting a certain level of electrical power, variable up to 5 A and 20 V depending on supported profile. The power configuration protocol uses a 24 MHz BFSK-coded transmission channel on the VBUS line.
Hier wird also ein spezielles Signal auf die Vbus-Leitung aufmoduliert (Vbus ist die "normale" 5V-Leitung im USB-Kabel).
Die Luft in den Nächten war gesättigt mit Luftfeuchtigkeit. Sichtweite war gegen 21 Uhr vielleicht noch 15-20m. Kein Wind.
Das sind genau die Bedingungen, die für Daune immer richtig schlecht sind. Normalerweise sollte das Zelt/Tarp gut durchlüftet sein, damit die entstehende Feuchtigkeit weggeht. Wenn aber draussen Nebel herrscht, hast du keine Chance. Mit einem offenen Zelt und Luftbewegung kann tatsächlich innert kürzester Zeit der Quilt durchnässt werden. Und wenn das Zelt dann geschlossen ist, hat man den ganzen Kondens von der eigenen Feuchtigkeit im Zelt drin.
In den Bergen versuche ich bei solchen Bedingungen manchmal, abends, wenn Nebel entsteht und es leicht windet, die Behausung möglichst zu schliessen. Idealerweise ist der Quilt dann noch sicher eingepackt. In der Nacht wird die Luft dann häufig klarer (und kälter), und dann öffne ich das Zelt wieder.
Ich könnte mir also vorstellen, dass das Problem am Ende gar nicht so sehr an dir und deiner schwankenden Temperatur liegt.